02.11.2023
Was soll das mit dem digitalen Euro?
Die Vorbereitungsphase für den digitalen Euro läuft an. Viele Menschen fragen sich: Was soll das, wer braucht den Digi-Euro überhaupt? Wir haben die Antworten.
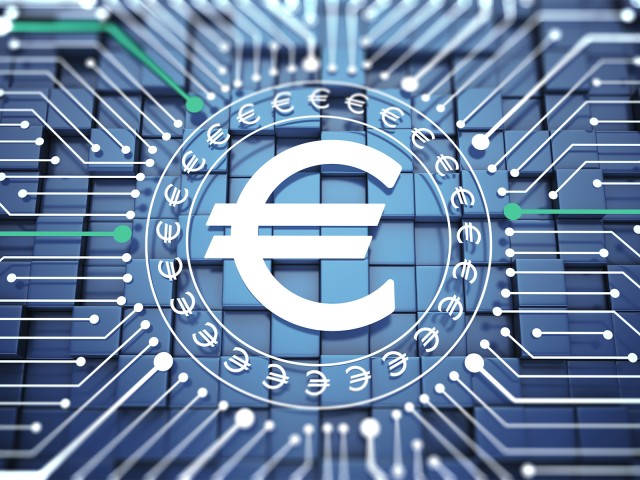

Zum Bezahlen zücken wir Karte oder Smartphone. Um Geld zu überweisen, loggen wir uns online ein. Auch wenn wir noch mit Münzen und Geldscheinen im Portemonnaie unterwegs sind: Die meisten Transaktionen wickeln wir digital ab. Wenn der Euro im täglichen Leben längst digital ist, warum brauchen wir dann einen digitalen Euro?
„Eine überaus verständliche Frage“, sagt Dr. Guido Zimmermann, Senior Economist bei LBBW Research. „Was nützt eine neue Lösung, wenn niemand ein Problem hat? Der Nutzen eines digitalen Euros dürfte für die Verbraucher sehr überschaubar sein.“ Die Menschen können bereits problemlos per Online-Banking, Debitkarte oder Zahlungsapp für das Smartphone digital bezahlen oder überweisen. Folgerichtig sehen 56 Prozent der Deutschen laut einer Umfrage der Bundesbank keinen Mehrwert in der Einführung eines Digi-Euro. „Selbst unter den Profis ist die Meinung geteilt“ über die Vorteile und Nachteile, sagt Zimmermann: „Von den Fach- und Führungskräften der Finanzindustrie sind fast die Hälfte der Meinung, dass es einen digitalen Euro nicht braucht.“
Das sieht die Europäische Zentralbank (EZB) anders: Im November 2023 ist mit den Vorbereitungen für die technische Entwicklung des Digi-Euros begonnen worden. In dieser Phase soll das Regelwerk für den digitalen Euro fertiggestellt sowie Anbieter ausgewählt werden, die eine Plattform sowie die Infrastruktur für einen digitalen Euro entwickeln könnten. Nach zwei Jahren will die EZB entscheiden, ob sie zur finalen Phase übergeht, um damit den Weg für eine Ausgabe und Einführung zu ebnen. Ab 2026 könnte der Digi-Euro wirklich kommen. „Die EZB sollte sich die Zeit nehmen, den Menschen den Sinn und Nutzen des digitalen Euro näherzubringen“, mahnt LBBW-Experte Zimmermann.
Der Nutzen des digitalen Euro dürfte für die Verbraucher sehr überschaubar bleiben.
Die Gefahr, dass der digitale Euro gar nicht gebraucht wird, sieht die Europäische Zentralbank nicht: Sie möchte mit dem Digi-Euro die Digitalisierung des Euroraums befördern. Wenn alles klappt, können Verbraucher und Unternehmen per App sicher, anonym und ohne weitere Kosten zahlen. So wie heute schon beim Bargeld. Denn die EZB-Digitalwährung soll das physische Bargeld nicht ersetzen, sondern nur ergänzen. Parallel arbeitet die Notenbank daran, die Eigenschaften des physischen Bargelds – Anonymität und die Möglichkeit der Offline-Zahlung – in den digitalen Raum zu übersetzen. In wichtigen Details hat sich die EZB bereits festgelegt.
Vorteile und Nachteile: die 10 wichtigsten Fakten zum digitalen Euro
- Digitaler Euro und „normaler“ Euro haben den gleichen Wert.
- Der digitale Euro ist ein gesetzliches Zahlungsmittel, das Händler und Unternehmer annehmen müssen.
- Die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Staaten des Euroraums haben direkten und kostenlosen Zugang zum digitalen Euro.
- Wer mit dem digitalen Euro überweist oder Geld erhält, muss der EZB dafür keine Gebühren zahlen.
- Allerdings erhält er auch sein digitales Guthaben nicht verzinst.
- Der Zugang zum digitalen Euro erfolgt wie bei der Eröffnung eines entsprechenden Kontos über Banken und Sparkassen.
- Für den täglichen Gebrauch können entsprechende Zahlungsverkehrs-Apps der Banken und Sparkassen oder eine EZB-App genutzt werden.
- Aufbauend auf einer Basislösung für den digitalen Euro können Banken und Sparkassen zusätzliche Zahlungsverkehrs-Apps anbieten.
- Zahlungen können kontaktlos, über QR-Codes oder andere Lösungen erfolgen.
- Die digitale Geldbörse, die mit dem digitalen Euro eingeführt wird, ist kompatibel mit einem weiteren großen Digitalisierungsprojekt der EU. Mit der sogenannten ID-Wallet sollen sich zukünftig Menschen digital ausweisen können.
Damit es nicht zu einem starken Abfluss von Einlagen von den Girokonten hin zum digitalen Euro kommt, werden Obergrenzen für die Bürgerinnen und Bürger eingeführt (z. B. 3.000 Euro).
Der letzte Punkt ist vor allem für Bürgerinnen und Bürger weniger stabiler EU-Staaten relevant. Es droht die Gefahr, bei einer Pleite ihrer lokalen Bank ihre gesamten Einlagen zu verlieren. Das eigene Geld über die App im Smartphone der sicheren Europäischen Zentralbank anzuvertrauen: Das wäre ein verständlicher Impuls. Die Obergrenze soll diesen Geldabfluss verhindern.
Damit Europa keine digitale Kolonie wird
Für die EZB wird es eine Herausforderung sein, den digitalen Euro erfolgreich einzuführen, während die Bevölkerung problemlos weiter ohne Digi-Euro leben kann. Die Entscheidung, im Euroraum eine digitale Währung einzuführen, ist vor allem ein Politikum: Die EZB will sich das Geldmonopol nicht von US-Konzernen wie Meta (früher: Facebook) aus der Hand nehmen lassen. Das Unternehmen hatte 2019 mit der Einführung einer eigenen Währung namens Libra geliebäugelt und damit die Bankenwelt aufgeschreckt. Auch wenn das Libra-Projekt mittlerweile eingestellt ist: Ähnliche Gedankenspiele beschäftigten auch andere Technologiekonzerne. Diese Gefahr ist real: „Europa muss gegensteuern und selbst eine digitale Währung anbieten“, sagt Zimmermann, „wenn es nicht zu einer digitalen Kolonie werden soll.“
Allerdings sieht Zimmermann die Chancen für den digitalen Euro nicht im privaten Zahlungsverkehr. Ein vielversprechendes Werkzeug könnte der Digi-Euro im kommerziellen Interbankenhandel sein – sofern er von der EZB programmierfähig gestaltet würde. Ein derartiger digitaler Euro würde das von den Banken gehaltene Zentralbankgeld vielseitig einsetzbar machen, zum Beispiel auf entsprechenden Blockchain-Plattformen. „Hier gibt es nicht unerhebliche Produktivitätspotenziale zu heben – insbesondere im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr. Und das käme am Ende auch dem Verbraucher zugute“, urteilt LBBW-Analyst Zimmermann.



